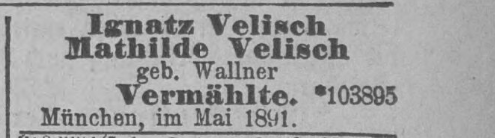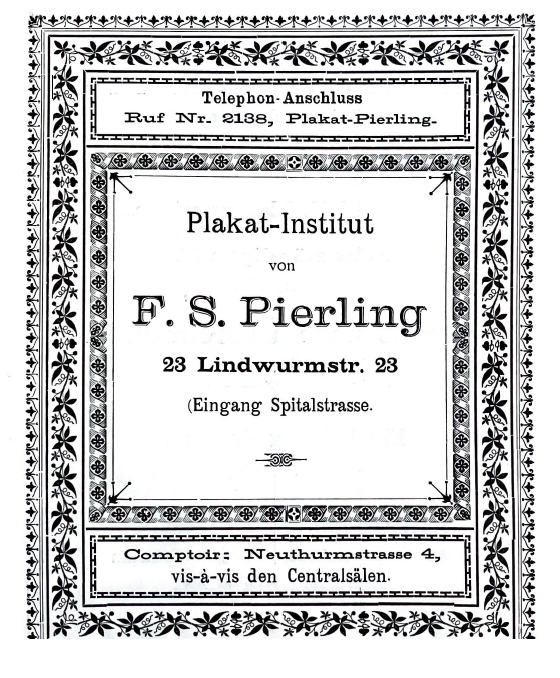Ignaz Velisch
Geboren am 25. Januar 1861 in Fünfkirchen (Pécs), Ungarn
Gestorben am 15. Februar 1937 in München
Herkunft
Hinsichtlich der Herkunft von Ignaz Velisch bestehen einige Fragezeichen. In den Münchner Meldeunterlagen war ursprünglich Kaposvár als Geburtsort eintragen. Dieser Eintrag wurde aber durchgestrichen und durch Fünfkirchen ersetzt. Die beiden Städte liegen rund 60 km voneinander entfernt. Fünfkirchen war damals eine Stadt der k. u. k. Monarchie und ist heute unter dem Namen Pécs eine der größten Städte Ungarns.
Ähnlich kompliziert verhält es sich mit seinem Nachnamen, ist er doch als Ignaz Wellisch am 25. Januar 1861 geboren. Später wurde der Name in Velisch geändert. Seine Eltern waren der Kaufmann Salamon (auch Salomon) und Fanny Wellisch, geb. Stern, geboren am 7. Mai 1828 in Kaposvár, gestorben am 4. Juni 1909 in München. Vom Vater wissen wir nur, dass er Kaufmann war. Das Paar hatten noch drei weitere Söhne:
Anton, geboren am 5. Januar 1855
Emil, geboren am 23. März 1863 und
Bela, geboren am 28. Januar 1866.
Alle drei Brüder wurden in Kaposvár geboren. Das Buchdruckerhandwerk erlernte Ignaz Velisch noch in seiner Heimat. Er war 16 Jahre alt, als er seine österreichisch-ungarische Heimat verließ.
München
1877 kam er nach Deutschland. Zunächst lebte er wohl in Nürnberg, zog aber bereits im Januar 1878 nach München. Er arbeitete damals als Maschinenmeister beim königlichen Hofbuchdrucker E. Mühltaler, vormals Druckerei Carl Robert Schurich.
Die ersten unternehmerischen Aktivitäten waren ab 1886 festzustellen. Zusammen mit seinem Partner Josef Eckhardt betrieb er einen „Papier- und Inseraten-Agentur Verlag“. 1892 hatte die Firma ihren Sitz in der Löwengrube 20 und war Besitzer des Anwesens, wie das Sternchen im Adressbuch verrät.
Anfang 1891 erwarb Ignaz Velisch die bayerische Staatsangehörigkeit sowie das Heimatrecht von München.
Wann und wie Ignaz Velisch seine spätere Frau, die Schauspielerin Mathilde Wallner, kennenlernte, wissen wir nicht. In den Münchner Neuesten Nachrichten vom 30. August 1890 gab das Paar seine Verlobung bekannt. Im Jahr darauf, am 14. Mai 1891, folgte die Hochzeit. Seine Frau, Mathilde Wallner war am 3. Februar 1870 in München zur Welt gekommen und war Katholikin, weshalb die Ehe später als sogenannte „Mischehe“ galt. Die Ehe der beiden blieb kinderlos.
Münchner Neueste Nachrichten 31.8.1890
Münchner Neueste Nachrichten 24.5.1891
1892 wagte Ignaz Velisch auch den Schritt in die Selbständigkeit.
Druckerei und Kunstanstalt
Das Arbeitsleben bzw. das Unternehmertum von Ignaz Velisch war äußerst vielfältig. In den Unterlagen finden sich eine Vielzahl von Firmengründungen, Beteiligungen, aber auch Konkursverfahren zu Druckereien und Plakatanstalten.
Bedeutend war wohl seine jahrzehntelange Beteiligung an den „Vereinigte(n) Münchener Plakat Instituten Hartl & Pierling“. Zusammen mit Kommerzienrat Franz Hermann Hartl und F. S. Pierling war er Mitinhaber dieser Firma. Die Firma warb damit, über 1.200 Plakatsäulen und Tafeln in allen Stadtbezirken zu betreiben.
Stadtarchiv München, DE-1992-BAUA-HB-1027-02
Stadtarchiv München, DE-1992-BAUA-HB-1027-02
Logo der Vereinigten Münchener Plakatinstitute Hartl & Pierling (aus Privatbesitz)
Ignaz Velisch trat im Tagesgeschäft der Firma nicht in Erscheinung. Die Beteiligung könnte eher eine strategische, finanzielle Teilhaberschaft gewesen sein, da die Firma über einen längeren Zeitraum Monopolstellung für die Plakatierung auf öffentlichem Grund hatte.
Im April 1900 erfolgte die Gründung der „Vereinigte(n) Druckereien & Kunstanstalt“, vormals Schoen & Maison bzw. Ignaz Velisch. Einige Jahre später trugen die Druckerzeugnisse den Firmennamen Münchener Graphische Kunstanstalt JG Velisch. Die Erzeugnisse der Druckerei waren vielfältig. Zum Programm des Verlages gehörten z. B. Reiseführer von München. Diese erschienen schon damals in einem praktischen Westentaschenformat, waren dreisprachig in deutsch, französisch und englisch und mit einer Einlegekarte von München versehen. Auch Zeitschriften wie etwa die unter dem Titel „Graphische Künste“ gab Ignaz Velisch heraus, bzw. ließ sie in seinem Haus drucken. Erhalten geblieben sind auch künstlerische Postkarten. Zum Produktionsspektrum gehörten außerdem Plakate.
Um die Jahrhundertwende galt München als eines der bedeutenden Zentren in der Plakatgestaltung. Mit seiner graphischen Kunstanstalt verstand es Ignaz Velisch, bedeutende Künstler dieser Zeit, wie Carl Kunst, Adolf Hengeler oder Ludwig Hohlwein, für die Herstellung von Werbeplakaten zu gewinnen. So berichteten die „Münchner Neuesten Nachrichten“ vom 24. November 1910 unter der Überschrift „Kleine Kunstnachrichten“ in einem recht ausführlichen Artikel von den neuesten Werbeplakaten. Schon die Überschrift zeigt, dass man die Werbemittel eher der Kunst als schnöden Druckerzeugnissen zurechnete. Wie sonst nur bei Kunstwerken beschreibt der Autor fast schwärmerisch die Darstellung, Farbgebung, Anordnung der Schrift zum Bild oder die Originalität des Motivs. Die Plakate der Künstler befinden sich heute in Kunstsammlungen wie den Staatlichen Museen zu Berlin, der Albertina in Wien oder dem Münchner Stadtmuseum.
Künstler: Paul Neuenborn um 1905 (Quelle: Stadtarchiv München Plakatsammlung DE-1992-PL-16246)
Reiseführer München, Vermutlich 1910
Festfuhrwerk der Bierbrauerei z. Thomasbräu, München, Künstler unbekannt, gedruckt bei der Münchner Graphischen Kunstanstalt von Ignaz Velisch.
Ignaz Velisch engagierte sich auch für das Gemeinwohl. 1902 wurde er als Schöffe bei Gericht bestellt.
Seine Mutter, Fanny Velisch, die ebenfalls in München lebte, verstarb 1909. Sie gehörte zu den ersten, die auf dem damals neu eröffneten Neuen Israelitischen Friedhof bestattet wurden. In den Münchener Adressbüchern taucht die Mutter Fanny erstmals 1887 als „Kaufmannswitwe“ auf. Die Familie wohnte im Gärtnerplatzviertel, was damals ein Zentrum jüdischen Lebens in München war. Dort lebten sehr viele aus dem Osten zugewanderte jüdische Bürger. Wann und wo Ignaz Velischs Vater Samuel Wellisch verstorben ist, konnten wir nicht in Erfahrung bringen.
Auf seinem Familienbogen sind unzählige Wohnungswechsel vermerkt. Auffällig ist dort der Eintrag „28.3.13 in Hamburg“. In Hamburg sind entsprechende Unterlagen kriegsbedingt nicht mehr vorhanden. Im Deutschen Reichsanzeiger vom 4. September 1913 wird im Handelsregister zum 23. August 1913 eine neue Firma eingetragen, die „Hamburger Plakat-Anschlags GmbH“. Geschäftsführer ist ein Ignaz Velisch, Kaufmann aus Hamburg. Mit den „Vereinigten Münchener Plakat Instituten Hartl & Pierling“ in München war wohl aufgrund der Monopolstellung ordentlich Geld verdient worden. Velischs Kompagnon, der Kommerzienrat Franz Hermann Hartl, wurde 1914 als „Gold-Millionär“ geführt. Die Vermutung liegt nahe, dass der Erfolg in einer anderen Stadt wiederholt werden sollte.
In Hamburg hielt es Ignaz Velisch nicht lange. Er meldete sich im Dezember 1915 nach Budapest ab, kehrte aber im Mai 1916 nach München zurück.
Ende Mai 1916 übersiedelte das Paar in die Elisabethstraße 12/A in Schwabing, wo es dann auch für lange Jahre wohnte.
Bad Wiessee
Im März 1931 meldeten sich die Velischs aus der Elisabethstraße 12/A nach Bad Wiessee am Tegernsee ab. Ignaz Velisch hatte kurz zuvor seinen 70. Geburtstag gefeiert. In der Lokalpresse hatte man sein Schaffen als das eines bekannten Fachmanns des graphischen Gewerbes gewürdigt. Die Gründe für den Umzug sind unklar, zumal die Idylle am See nationalsozialistische Prominenz anzog. So hatte etwa Heinrich Himmler eine Villa am See, und Ernst Röhm logierte zeitweise in Bad Wiessee und wurde dort verhaftet.
Allerdings geht aus den Wiedergutmachungsakten hervor, dass Mathilde Velisch seit 1930 ein Haus in Bad Wiessee besaß, in dem das Paar im Ruhestand lebte. Ende 1936 verkaufte sie das Haus jedoch wieder. Die Gründe für den Verkauf sind unklar.
Man kann aber vermuten, dass der jüdische Unternehmer im Ruhestand dort zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gern gesehen war.
Ab dem 8. Januar 1937 war das Paar wieder in der Elisabethstraße gemeldet. Sie hatten die Straße wohl in guter Erinnerung, da die neue Wohnung nur wenige Meter von ihrer vormaligen Wohnung entfernt war. Im Haus mit der Nummer 30, im ersten Stock, hatten sie eine neue Wohnung gefunden. In diesem Haus lebten weitere jüdische Bürger, Lilly und Max Rothschild. Alice und Isidor Neuburger, bei denen Siegfried Gerstle zur Untermiete wohnte, zogen erst kurz nach dem Tod von Ignaz Velisch ein.
Kurz nach dem Umzug in die Elisabethstraße 30 verstarb Ignaz Velisch mit 76 Jahren, am 15. Februar 1937.
Erinnerung
Quelle: Kulturreferat der Landeshauptstadt München, Foto Jonas Nefzger
Seit dem 22. Oktober 2025 gibt es vor dem letzten Wohnort von Ignaz Velisch und weiteren Bewohnern des Hauses in der Elisabethstraße 30 in München-Schwabing ein Erinnerungszeichen.
Schicksal weiterer Familienangehöriger
Seine Ehefrau, Mathilde Velisch, trat ab 1892 als Schauspielerin in Erscheinung. So spielte sie beim „akademisch-dramatischen Verein“ in Gerhart Hauptmanns „Einsame Menschen“. Der Kritiker vermerkte: „Als Dilettanten boten alle Mitwirkende sehr schöne Leistungen“. 1895/96 stand sie häufiger beim „Theater am Gärtnerplatz“ auf der Bühne. Bei den Stücken handelte es sich um Stücke mit einem ausgeprägten Lokalkolorit. So spielte sie die „Afra“ in „Der Geigenmacher von Mittenwald“, die „Käthe“ in „Frau Müller“ oder das „Liserl“ im Stück „’s Lieserl vom Schliersee“. Die Kritiken im Feuilleton sind nicht überragend:
Münchener Ratsch-Kathl 21. und 28.8.1895
Anfang des 20. Jahrhunderts fuhr die „Buchdruckereibesitzersgemahlin“ oder wahlweise „Direktorengattin“ regelmäßig zur Kur nach Franzensbad. Sie ist dort in den „Curlisten“ zu finden. Sie überlebte ihren Mann um einige Jahre und starb am 13. Mai 1947 in München.
Ignaz‘ Bruder Anton Velisch verstarb am 19. November 1908 in New York. Er hatte am 4. Dezember 1880 in Kaposvár Theresa Mautner geheiratet, geboren am 25. Juni 1858 in Kaposvár und verstorben am 2. Mai 1929 in München. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor, Elisabeth und Ladislaus.
Ein weiterer Bruder, Emil Velisch, heiratete im Mai 1892 Gisela Urbach. Er betrieb u. a. das „Münchner Annoncen Bureau“ und war Herausgeber der Bayerischen Bürger-Zeitung. Emil Velisch verstarb am 17. April 1920 in Eglfing/Haar. Das Paar hatte fünf Kinder.
Der dritte Bruder Bela Velisch war Zeitungsverleger, Vertreter und Journalist. Er heiratete Walburga Hierl, lebte aber ab 1915 von seiner Frau getrennt. Das Paar hatte zwei Söhne, Desider Eugen Bela, geboren am 13. März 1902 in München, sowie Erich Fritz, geboren am 15. Juni 1904 in München. Bela Velisch verstarb am 17. Februar 1941 in München.
Text und Recherche
Stefan Dickas
Quellen
Staatsarchiv München, Polizeidirektion München 15252.
Stadtarchiv München, ZA-P-547-12.
Stadtarchiv München, EMK zu Ignaz Velisch.
Stadtarchiv München, EMK zu Anton und Ladislaus Velisch, DE-1992-EWK-65-F90 und DE-1992-EWK-NS-Fel-Kas.
https://digipress.digitale-sammlungen.de/ Münchner Neuste Nachrichten vom 10.02.1891, 20.12.1892, 5.9.1894, 24.8.1895, 9.9.1895, 16.9.1895, 21.11.1902, 19.4.1920 und 27.1.1931 Münchener Ratsch-Kathl 21. und 28.8.1895.
www.digitale-sammlungen.de Münchner Adressbuch von 1892.
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/newspaper hier Deutscher Reichsanzeiger vom 7.5.1900, 4.9.1913.
Gedenkbuch München Eintrag zu zu Ignaz Velisch https://gedenkbuch.muenchen.de/index.php?id=gedenkbuch_link&gid=11068 und zu Bela Velisch https://gedenkbuch.muenchen.de/index.php?id=gedenkbuch_link&gid=6173 sowie dem Auszug aus der Datenbank Biografischen Gedenkbuch der Münchner Juden (Stand 20.10.2021).
https://anno.onb.ac.at Curliste Franzensbade 15.6.1901, 8.6.1905, 14.6.1907 und 28.6.1911 sowie Budapesti Czim-és lakás jegyzék. Budapester Adressen- und Wohnungs-Anzeiger des Franklin-Vereins: Hauptteil 1914 und 1916.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:Q2DJ-ZDPL?lang=de Grab der Mutter, Fanny Velisch.
Literatur
Rudolf Martin: Jahrbuch des Vermögens und Einkommens der Millionäre in Bayern 1914, Verlag Rudolf Martin Berlin, 1914.
Krauss, Marita (Hrsg.): Die bayerischen Kommerzienräte, Volk Verlag 2016.